
Häufig gestellte Fragen zur Behandlung von Divertikulitis
Bei Verdacht auf eine Divertikulitis muss ein Arzt kontaktiert werden. Dieser kann Ihnen Empfehlungen für die richtige Behandlung geben und bei Bedarf Medikamente verschreiben. Wurde die Diagnose bereits gestellt, ist es ratsam, sich auszuruhen und den Bauch mit einer Wärmflasche zu entspannen. Auch das Trinken von Kräutertees kann helfen. Nehmen die Beschwerden jedoch zu, sollte erneut Ihr Arzt konsultiert werden, um weitere Behandlungsschritte einzuleiten.
Antibiotika helfen, die bakterielle Infektion unter Kontrolle zu halten und damit die Entzündungsprozesse im Darm zu reduzieren. Die Wahl und Dauer der Antibiotika-Therapie hängt von der Schwere der Erkrankung ab und wird vom behandelnden Arzt festgelegt. Bei unkompliziertem Verlauf wird heute häufig auf die Gabe von Antibiotika verzichtet.1 Denn antibiotische Arzneimittel haben auch Nebenwirkungen (wie Durchfall). Zudem reduzieren sie zum Beispiel auch die nützlichen Darmbakterien im Verdauungstrakt. Dadurch wird die natürliche Darmflora gestört, was der Gesundheit des Körpers dann mehr schaden als nützen kann. Eine weitere Gefahr ist die Bildung von Resistenzen.
Bei einem komplizierten Verlauf wird häufig ein Antibiotikum (Saft, Tablette, Infusion) verabreicht, um zu verhindern, dass sich Entzündung weiter ausbreitet. Krampflösende Mittel, sogenannte Spasmolytika, wirken gegen Schmerzen bei Krämpfen.1 Nicht steroidalen Antirheumatika (NSAR) wie Schmerzmittel (zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac) sollten bei einer Divertikulitis nicht eingenommen werden. Sie können das Risiko für eine Darmperforation erhöhen.
Bei einer Divertikulitis treten häufig Symptome wie Blähungen, Durchfälle und Verstopfung auf. Diesen Beschwerden können Betroffene mit Hausmitteln entgegentreten: Beispielsweise hat Kamillentee eine entspannende, krampflösende Wirkung. Auch lokale Wärmeanwendungen mit Kirschkernkissen oder Bauchwickeln verschaffen Linderung. Die Wärme sorgt für eine entspannte Magen- und Darmmuskulatur. Einen ähnlichen Effekt hat eine sanfte Bauchmassage. Es empfiehlt sich, die Anwendung von Hausmitteln zunächst mit dem behandelnden Arzt abzustimmen.
Wer an Blähungen oder leichten Bauchkrämpfen leidet, sollte zu Tee mit Pfefferminze, Anis, Kümmel oder Fenchel greifen. Auch Kamille ist ein Klassiker bei Verdauungsproblemen und hat einen entspannenden sowie krampflösenden Effekt.
Eine Divertikulitis-OP ist dann notwendig, wenn konservative Therapien (zum Beispiel Ernährungsumstellung) nicht ausreichen oder schwere Komplikationen wie Abszesse oder Perforationen (Risse in der Darmwand) im Zusammenhang mit den Entzündungen auftreten. Ein möglicher chirurgischer Eingriff ist die Entfernung des entzündeten Dickdarmabschnitts (Sigmaresektion). Dies kann zum Beispiel laparoskopisch (minimal-invasiv) oder offen chirurgisch (Öffnung der Bauchdecke) erfolgen.1
Die Diagnose der Divertikulitis
Bei Verdacht auf eine Divertikulitis werden Betroffene von ihrem Hausarzt an einen Gastroenterologen (Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen) überwiesen. Der Mediziner erkundigt sich zunächst nach den Symptomen und möglichen Vorerkrankungen (Anamnese). Außerdem erfolgt eine körperliche Untersuchung. Daneben kommen in der Regel auch bildgebende Verfahren wie ein Ultraschall oder eine Darmspiegelung (Koloskopie) zum Einsatz, mit denen sich der Mediziner ein genaueres Bild der Ausstülpungen verschafft.
Steht die Diagnose dann immer noch nicht fest, wird eine Computer- oder Magnetresonanztomografie durchgeführt. Mithilfe einer Blutuntersuchung lassen sich erhöhte Entzündungswerte feststellen, die ebenfalls auf eine Divertikulitis hindeuten. Je nach Befund unterscheidet der Gastroenterologe zwischen verschiedenen Stadien:
- akute unkomplizierte Divertikulitis: leichte Schmerzen im linken Unterbauch, eventuell Fieber
- akute komplizierte Divertikulitis: Druckschmerz, verhärteter Bauch, Fieber, erhöhtes Risiko von Komplikationen (Blutungen der Divertikel, Abszess- und Fistelbildung, Darmverschluss)
- chronische Divertikulitis: immer wiederkehrende Beschwerden
Medikamentöse Behandlung einer Divertikulitis

Bei etwa 95 Prozent der Menschen mit unkomplizierter Divertikulitis heilt die Entzündung innerhalb einer Woche ab.1 Bei etwa 5 Prozent der Betroffenen bleiben die Beschwerden bestehen und erfordern weitere Behandlungsmaßnahmen.1 Zu den möglichen medikamentösen Therapien gehören:
Antibiotika zur Therapie der Divertikulitis
Auf den Einsatz von Antibiotika kann bei unkomplizierter Divertikulitis zum Teil verzichtet werden. Das ist dann der Fall, wenn beispielsweise eine Ultraschalluntersuchung oder Computertomographie durchgeführt wurde und keine größeren Entzündungen oder sichtbaren Abszesse vorliegen. Bei bestimmten Patientengruppen ist die Gabe von Antibiotika allerdings empfehlenswert, da es bei ihnen leichter zu Komplikationen kommen kann. Dazu gehören Menschen mit folgenden Krankheiten:1
- chronische Nierenerkrankung
- Immunschwäche
- Bluthochdruck
- Allergien
Ob die Antibiotikatherapie ambulant zu Hause durchgeführt werden kann oder der Patient zur Beobachtung in ein Krankenhaus muss, entscheidet der Mediziner. Im Krankenhaus werden meist Antibiotika-Infusionen über eine Vene verabreicht, wodurch das Medikament direkt ins Blut gelangt. Diese Art der Behandlung erfolgt bei einer komplizierten Divertikulitis.
Bei einem unkomplizierten Verlauf wird Antibiotikum oral verabreicht. Das hat den Vorteil, dass eine ambulante Behandlung des Patienten möglich ist. Nachteilig ist hingegen: Da der Wirkstoff des Antibiotikums erst über den Verdauungstrakt ins Blut gelangt, gibt dies der Entzündung mehr Zeit, sich auszubreiten. Ob und wie die Medikamente angewandt werden, ist daher im Einzelfall zu entscheiden.
Wie lange müssen Antibiotika eingenommen werden?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Dauer der Einnahme richtet sich nach dem entsprechenden Wirkstoff sowie der Schwere der akuten Divertikulitis. Wichtig ist jedoch, das Betroffene die Arznei immer genau nach Angabe ihres Arztes einnehmen und nicht frühzeitig die Behandlung abrechen.
Antibiotische Medikamente werden normalerweise gut vertragen. Nebenwirkungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Einnahme von Antibiotika kann zu allergischen Hautreaktionen oder zu einer Störung der Darmflora (Dysbiose) führen — die Folge ist beispielsweise Durchfall.2 Lesen Sie daher aufmerksam den Beipackzettel und wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Arzt oder Apotheker.
Schmerzmittel bei Divertikulitis
Die Gabe von Schmerzmitteln (Analgetika) trägt zu einer Linderung der Schmerzen bei. Nicht-steroidale Antirheumatika (wie Ibuprofen oder Diclofenac) sollten jedoch nicht eingenommen werden, da sie unter Umständen einen Darmdurchbruch begünstigen können.2 Paracetamol ist hier die bessere Wahl. Jedoch sollten Sie sich von einem Arzt oder Apotheker beraten lassen, welche Schmerzmittel für Sie geeignet sind.
Probiotika: Unterstützung für den Darm
Probiotika sind spezielle Präparate, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten, zum Beispiel Milchsäurebakterien und Hefen. Sie werden in der Regel eingenommen, wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten ist, zum Beispiel nach einer Magen-Darm-Infektion oder der Einnahme von Antibiotika. Ihr Ziel ist es, die Darmflora zu regenerieren und so die Darmgesundheit zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Probiotika mit unterschiedlichen Bakterienstämmen. Daher ist es ratsam, vor der Auswahl eines Probiotikums einen Arzt oder Apotheker zu konsultieren, der Sie zu einem geeigneten Präparat berät.
Und was sind Präbiotika?
Bei der Darmsanierung werden neben Probiotika häufig auch Präbiotika eingesetzt. Dabei handelt es sich um unverdauliche Kohlenhydrate, die den nützlichen Darmbakterien als Nahrung dienen. Diese hilfreichen Bakterien kommen in bestimmten Lebensmitteln wie zum Beispiel Chicorée, Knoblauch oder Spargel vor. Sie sind aber auch in entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch Kombinationen von Prä- und Probiotika, die dann als Synbiotika bezeichnet werden.
Ernährungstherapie bei entzündeten Divertikeln
Die Ernährung spielt bei der Vorbeugung und Behandlung von Divertikulitis eine entscheidende Rolle. So gilt beispielsweise ein Mangel an Ballaststoffen als mögliche Ursache für die Bildung von Ausstülpungen in der Darmschleimhaut (Divertikel), die später zu Entzündungen im Darm und damit zur Divertikulitis führen können.
Besteht jedoch eine akute Divertikulitis, sollte dem entzündeten Darm beispielsweise vorerst Ruhe gegönnt und Schonkost einer ballaststoffreichen Ernährung vorgezogen werden.
Hausmittel und alternative Therapien von Divertikulitis
Eine Behandlung durch einen Mediziner wird dringend empfohlen, um Folgen wie Abszesse zu vermeiden. Dennoch können auch Hausmittel (gerade bei einer chronischen Divertikulitis, einem leichten Krankheitsverlauf oder vorbeugend) unterstützend angewandt werden. Mögliche Maßnahmen sind:
- Natürliche Stuhlweichmacher: Ballaststoffe können helfen, die Stuhlkonsistenz zu regulieren und Verstopfung vorzubeugen, was bei der Entstehung von entzündeten Divertikeln eine Rolle spielen kann. Flohsamenschalen gehören beispielsweise zu Lebensmitteln mit einem besonders hohen Anteil an Ballaststoffen. Die Einnahme sollte vorab mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Beispielsweise sind bei einem akuten Divertikulitis-Schub Ballaststoffe eher zu meiden.
- Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel: Einige Kräuter in Form von Tee (zum Beispiel Pfefferminze, Kamille, Kümmel) und Nahrungsergänzungsmittel (Probiotika) haben eine positive Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt. Divertikulitis Patienten sollten jedoch auch hier kurz Rücksprache mit ihrem Arzt halten.
- Wärmebehandlung: Die Anwendung von Wärme in Form von warmen Kompressen oder Wärmflaschen kann Bauchschmerzen und Krämpfe lindern. Jedoch sollten die Wärmeanwendung nicht zu heiß sein, um Hautreizungen zu vermeiden. Auch Kirschkernkissen oder warme Wickel sind geeignet.
Bitte beachten: Alternative Behandlungen und Hausmittel sollten nicht als Ersatz für eine angemessene medizinische Versorgung dienen. Bei akuten Symptomen oder Verdacht auf entzündete Divertikel ist es immer ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Nur ein Mediziner kann die richtige Diagnose stellen und dementsprechend die Therapie einleiten.
Divertikulitis-OP: Chirurgische Eingriffe zur Behandlung
Operationen kommen heute vor allem bei komplizierten Entzündungsverläufen in Betracht. Gründe für eine OP bei entzündeten Divertikeln können sein:3
- große Abszesse
- ein Durchbruch des entzündeten Divertikels
- Engstellen im Darm
- sehr starke Blutungen
- Fisteln (unnatürliche Verbindungen zwischen Hohlorganen)
- andere Therapien schlagen nicht an
- immer wiederkehrende Entzündungen (chronische Divertikulitis)
Die Entscheidung für eine Operation bei einem chronischen Verlauf der Divertikel-Krankheit wird sorgfältig abgewogen. Nur in Notfallsituationen, wenn beispielsweise entzündete Divertikel durchbrechen und so keimhaltiger Darminhalt in die Bauchhöhle gelangt, wird sofort operiert.
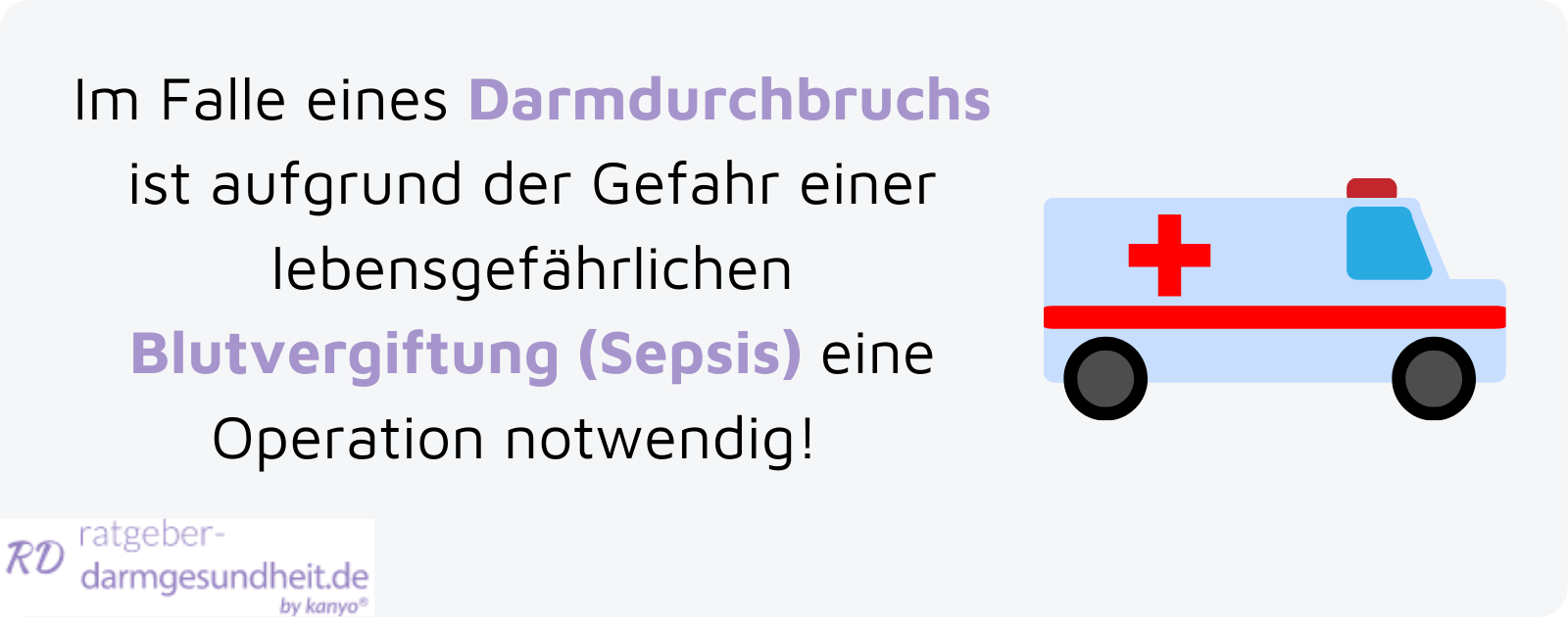
Operationsverfahren bei Divertikulitis
Der chirurgische Eingriff erfolgt nahezu ausnahmslos unter Vollnarkose. Bei einer geplanten Operation muss der Darm vollständig entleert sein. Das heißt, der Patient darf am Vortag der Operation nichts essen und muss Abführmittel zu sich nehmen. Dadurch soll vermieden werden, dass während des Eingriffs Darminhalt in den Bauchraum gelangt.
Der Chirurg entscheidet, ob ein großer Bauchschnitt oder ein laparoskopisches Verfahren sinnvoll ist. Unter Letzterem versteht man eine „Schlüsselloch-Technik“, bei der der Chirurg nur eine kleine Öffnung in der Bauchhöhle schaffen muss. Über diese werden dann Behandlungsinstrumente eingeführt. In der Regel ist dieser minimalinvasive Eingriff die Operation der Wahl.
Der Großteil der Divertikel entsteht im Sigma, dem Abschnitt des Dickdarms vor dem Mastdarm, da hier der Druck des Stuhlgangs am höchsten ist. Deshalb wird meist dieser Teil (zusammen mit einem Stück des Mastdarms) entfernt. Anschließend näht der Chirurg die beiden Enden des Darms wieder zusammen. Sollten die Enden stark entzündet oder geschädigt sein, hat der Arzt zudem die Möglichkeit, einen künstlichen Darmausgang (Stoma) zu legen, um die frische Naht vorrübergehend zu entlasten. Dieser kann nach wenigen Wochen im Rahmen einer kleinen Operation wieder entfernt werden.3
Erholungsphase und Nachsorge
Ein Eingriff am Darm ist generell nicht ohne Risiko. Es kann beispielsweise zu Komplikationen wie einer undichten Naht, Abszessen, Wundinfektionen oder Blutungen kommen. Anschließend müssen Operierte daher einige Tage im Krankenhaus bleiben und sich mehrere Wochen körperlich schonen.
Zudem dürfen Patienten in den ersten Tagen nur flüssige Nahrung (zum Beispiel Suppen oder Joghurt) zu sich nehmen. Danach werden sie langsam an eine magenschonende feste Kost herangeführt. In der Zukunft müssen die Patienten dann vermehrt auf eine ballaststoffreiche Ernährung achten. Hier steht idealerweise ein Diätassistent beratend zur Seite. Die weitere Nachsorge erfolgt nach der Entlassung entweder in der Sprechstunde des behandelnden Krankenhausarztes oder durch den Hausarzt. Auch die Fäden werden meist in der Hausarztpraxis gezogen.3
Lebensstilveränderung zur Unterstützung der Divertikulitis-Therapie
Wie wir leben hat nicht nur einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden, sondern auch auf unsere Darmgesundheit. Der Darm trägt maßgeblich zum Ablauf von Körperfunktionen sowie einem intakten Immunsystem bei. Folgende Faktoren sollten Sie daher im Hinblick auf Ihre Lebensgewohnheiten beachten:
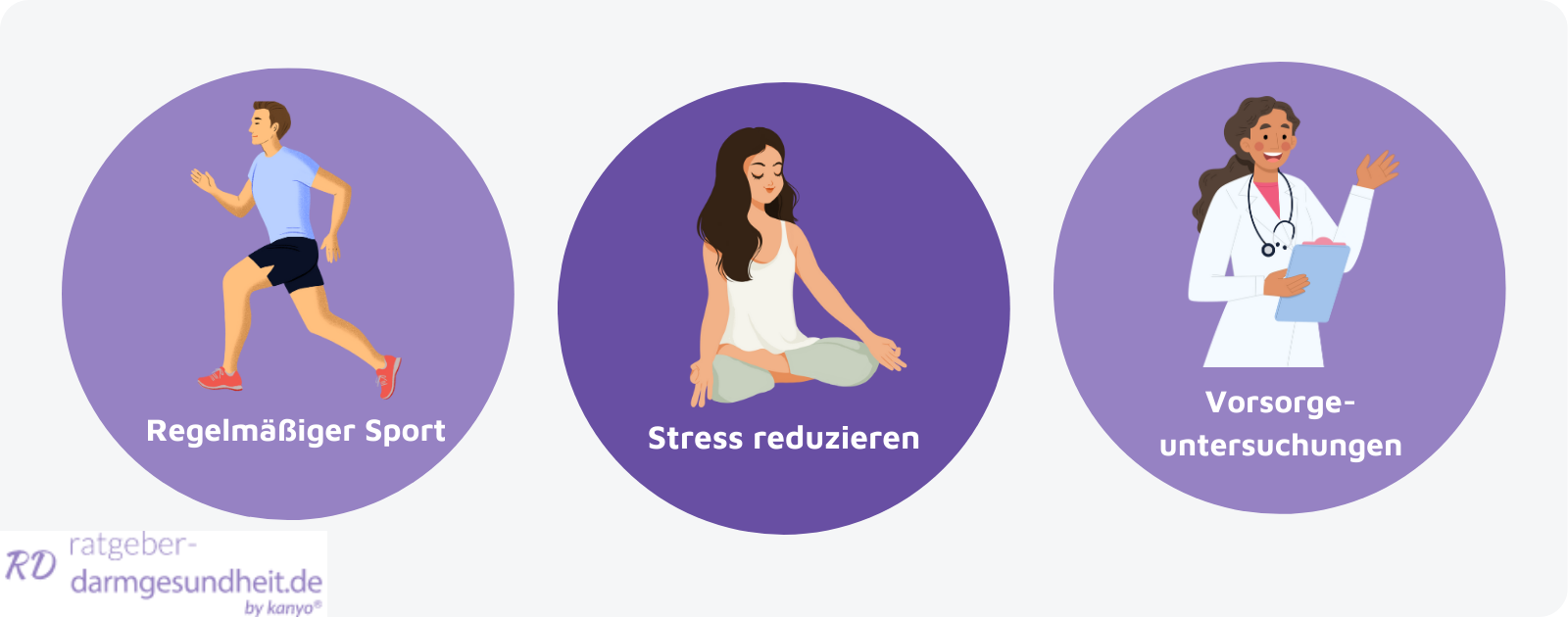
- Körperliche Aktivität: Regelmäßige körperliche Bewegung spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Darmgesundheit, einschließlich der Vorbeugung und Behandlung entzündeter Divertikel. Sport fördert die Durchblutung des Darms, unterstützt die Verdauung und kann Verstopfung vorbeugen. Auch moderate körperliche Aktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren oder leichte Gymnastik sollten in den Alltag integriert werden.
- Stressbewältigung: Psychische Belastungen können sich negativ auf die Magen- und Darmgesundheit auswirken und so die Symptome entzündeter Divertikel verschlimmern. Techniken zum Stressabbau wie Meditation, Yoga, Atemübungen oder regelmäßige Pausen können helfen, das Stresslevel zu senken. Das unterstützt im Allgemeinen die Gesundheit und trägt zu einem gesunden Lebensstil bei.
- Vorsorgeuntersuchungen: Ärztliche Beratung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um die Darmgesundheit zu überwachen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Menschen mit einer Vorgeschichte von Divertikulitis oder anderen Darmproblemen sollten sich daher regelmäßig untersuchen lassen, um erneute Beschwerden zu verhindern.
Die Umsetzung dieser Lebensstiländerungen erfordert immer einen individuellen Ansatz. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und eine andere Krankengeschichte. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um persönliche und auf Sie abgestimmte Informationen zu erhalten.